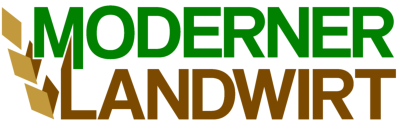Alternativen zu dieselbetriebenen Maschinen für Hof und Acker sind in der Landwirtschaft keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits für viele Funktionen einsatzfähig: Dies wurde beim Praxistag Alternative Antriebsenergien für Landmaschinen deutlich, den die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) zusammen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Echem (Kreis Lüneburg) veranstaltete.
Auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen Bildungszentrums der Kammer zeigten LWK-Fachleute für Landtechnik sowie Mitarbeiter von Herstellern und Vertriebsunternehmen elektrisch betriebene Rad- und Teleskoplader, Futterschiebe- und Stallreinigungsroboter, einen E-Futtermischwagen, eine elektrisch betriebene Aufsitzmaschine für Stallreinigung und Futtervorlage, eine Saat-Drohne, E-Traktoren sowie Traktoren, deren Verbrennungsmotoren mit Rapsöl und mit Hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden, im praktischen Einsatz.

Ministerin: Alternativen mit vielen Vorteilen
Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte machte sich vor Ort ein Bild:
„Der Landwirtschaftssektor ist auf zuverlässige, bezahlbare Technik angewiesen. Gleichzeitig müssen Emissionen sinken und eine Unabhängigkeit von fossilen Kraftstoffen entstehen. Der Praxistag zeigt, es gibt bereits verfügbare Maschinen und eine Reihe alternativer Antriebstechnologien. Klar ist aber auch, es muss und wird weiter vorangehen. Ein Zurück zu rein mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeugen kann und wird es nicht geben.“
Dies bringe viele Vorteile mit sich, führte die Ministerin aus:
„Wenn Pflanzenkraftstoffe regional und nachhaltig produziert werden, stärkt das die Wertschöpfung vor Ort und schafft Unabhängigkeit. Wenn vollelektrische Maschinen direkt über Photovoltaik auf dem Stalldach geladen werden, zahlt das doppelt ein: auf das Klima und in den Geldbeutel des Betriebs. Insofern muss die neue Bundesregierung entsprechende Förderinstrumente auf den Weg bringen, die Dynamik, Innovationsgeist und Investitionsbereitschaft fördern.“

E-Antrieb für Arbeiten im Stall und auf Betriebsgelände
„Gerade für Arbeiten im Stall und auf dem Betriebsgelände sowie bei Traktoren bis etwa 100 PS Leistung ist der Elektroantrieb zunehmend als interessante Alternative zum Dieselmotor anzusehen“, berichtete Dr. Harm Drücker, bei der LWK Leiter des Fachbereichs Landtechnik, Energie, Bauen, Immissionsschutz und einer der Organisatoren des Praxistages. Betriebe, die Solarstrom produzierten, könnten diesen zum Laden ihrer E-Fahrzeuge und -Maschinen nutzen. „Bei Landmaschinen mit höherer Leistung ist ein Elektroantrieb derzeit noch nicht praktikabel – entsprechende Batterien wären zu schwer, die erforderlichen Ladezeiten zu lang“, so Drücker.

Insbesondere bei Hofladern gebe es bereits eine brauchbare Auswahl an E-Modellen, ergänzte Martin Vaupel, Schlepper- und Transporttechnik-Experte der LWK. „Zwar sind elektrisch betriebene Fahrzeuge in der Regel deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner-Modelle; bei unserem Hoflader-Test im Jahr 2023 haben wir jedoch festgestellt, dass manche Elektromodelle – eine staatliche Förderung und günstigen Strom etwa aus eigenen Photovoltaikanlagen vorausgesetzt – bei der Wirtschaftlichkeit ihren Verbrenner-Pendants überlegen sein können.“

Schwetje: Wichtig ist nahtlose Integration in betriebliche Abläufe
„Ein erfolgreicher Umstieg von Diesel auf alternative Antriebsenergien gelingt, wenn die neuen Antriebstechnologien nahtlos in die betrieblichen Abläufe integriert werden können“, sagte Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Gleichzeitig müsse der Zugang zu alternativen Energieträgern sicher und bezahlbar sein, ergänzte der Kammerpräsident. Wer den Wandel aktiv gestalte, könne nicht nur Emissionen senken, sondern auch neue Spielräume in der Energieversorgung und Wirtschaftlichkeit erschließen.

Elektroantrieb für kleine und mittlere Landmaschinen
Gerade bei Maschinen mit niedrigerer Leistung sehen Fachleute sehr gute Chancen, dass der Elektroantrieb den Verbrennungsmotor ersetzen kann – dies wurde in den Vorträgen des Echemer Praxistages deutlich. „Kleine und mittlere Landmaschinen werden batteriegetrieben sein“, stellte etwa Professor Ludger Frerichs, Leiter des Instituts für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge an der Technischen Universität (TU) Braunschweig, fest. Insgesamt geht Frerichs von einem Energiemix mit batterieelektrischen und verbrennungsmotorischen Antrieben aus: „Jeder Betrieb ist anders, jeder muss seinen wirtschaftlich passenden Energiemix fahren.“

Flüssige Alternativen zum fossilen Dieselkraftstoff
Neben Strom werden flüssige Alternativen zum fossilen Dieselkraftstoff stark gefragt sein, um deutsche und EU-Klimaschutzziele zu erreichen – auch darin waren sich die Referenten einig. „Nach heutigen technischen Möglichkeiten werden flüssige, erneuerbare Kraftstoffe in der Landwirtschaft in der näheren Zukunft die größte Bedeutung haben“, sagte Dr. Hartmut Matthes, Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnunternehmen. „Besonders gilt das für Landmaschinen höherer Leistungsklassen, während hof-nahe Fahrzeuge und untere Leistungsklassen organisatorisch gut mit batterie-elektrischen Antrieben nutzbar sind.“ Fossiler Dieselkraftstoff habe keine Zukunft – kurzfristig und sehr CO2-wirksam gelte es auf pflanzenbasierte Kraftstoffe zu setzen, am schnellsten auf HVO und Biodiesel, bekräftigte TU-Dozent Frerichs.

Industrie benötigt Planungssicherheit
Das Verständnis für die landwirtschaftlichen Anforderungen und Nutzungsprofile stelle die Grundlage für die Transformation dar, sagte Dr.-Ing. Johannes Hipp, Landtechnikexperte beim Maschinenbau-Branchenverband VDMA. „Planungssicherheit ist die Grundvoraussetzung für die Landtechnikindustrie.“ Bereits heute sei der Großteil der Maschinen zum Beispiel HVO-ready, könne also mühelos von fossilem auf nachwachsenden Treibstoff umsteigen.
Effektive Anreize zur Nutzung biogener und erneuerbarer Energieträger seien der erste Schritt, um den Umstieg bei Herstellern und Anwendern einzuleiten, führte Hipp weiter aus „Dazu ist allerdings der politische Wille nötig, in Sachen alternative Kraftstoffe endlich klar und deutlich zu handeln.“ Die Landwirtschaft selbst könne dem Umstieg durch eine entsprechende Anbauplanung gut praktisch umsetzen, ergänzte Frerichs: „Wir benötigen nur wenige Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für den Ersatz des fossilen Diesels in der Landwirtschaft.“

Betriebe stehen vor bedeutenden Entscheidungen
Aus Sicht von Lohnunternehmen-Vertreter Matthes spielen bei der Umsetzung dieser Energiewende im Tank und im Speicher eine Reihe von Kriterien eine bedeutende Rolle, damit die Unternehmen bei der Antriebsenergie ihrer Maschinen die für sie richtige Entscheidung treffen können: „Dies beginnt bei den Möglichkeiten bei der Beschaffung der Landmaschinen und Energieträger – zu bedenken sind verfügbare Modelle und eine passende Lade-Infrastruktur“, erläuterte Matthes. „Weiterhin gilt es, die Wirkung der neuen Technologien auf die Produktionsverfahren abzuschätzen, etwa was die Kompatibilität zu vorhandenen Geräten anbelangt.“
Zu berücksichtigen seien außerdem die Wirkungen auf die Arbeitswirtschaft, etwa was Tank- und Ladevorgänge sowie das Handling der Energieträger betreffe, führte der Lohnunternehmer weiter aus. „Und schließlich sollte die Wirtschaftlichkeit der alternativen Antriebsenergien bewertet werden: Hierzu gehören Aspekte wie Investitionskosten und Investitionssicherheit, mögliche Förderungen, Einflüsse auf die Wettbewerbsfähigkeit und auf den ökologischen Fußabdruck der Agrarprodukte.“
Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Bildquelle: Ehrecke/Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Entdecke mehr von Moderner Landwirt
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.